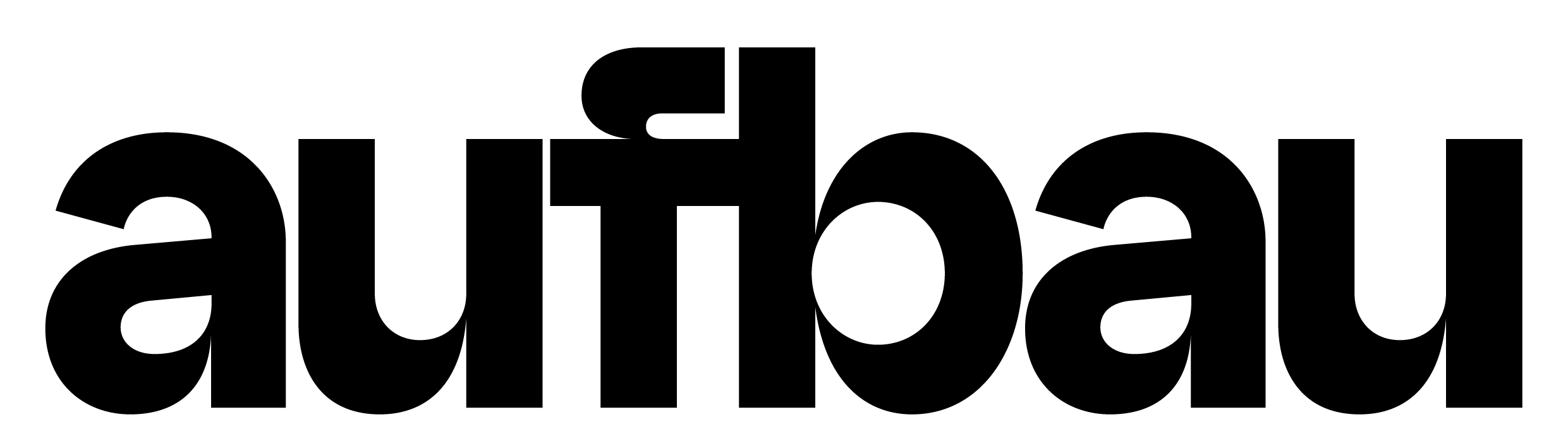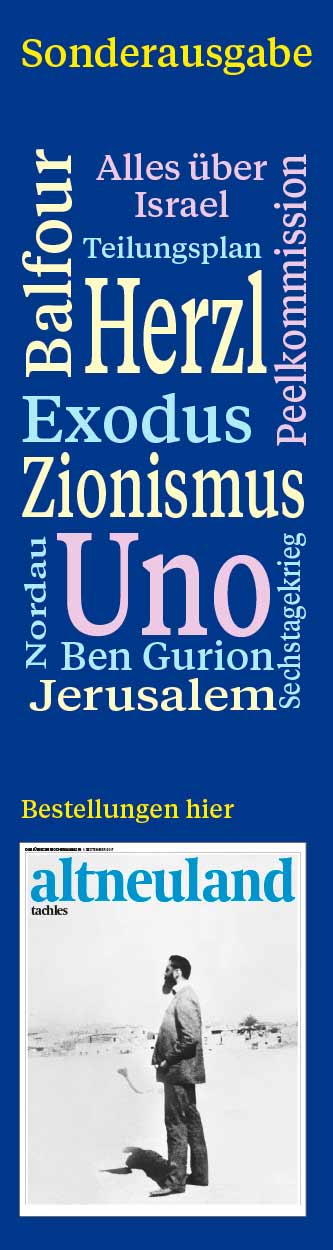Sibylle Berg spricht mit Filmemacher Arkadij Khaet über seine Arbeit, über Zuschreibungen, die deutsche Erinnerungskultur – und warum er in seinen Filmen versucht, jüdisches Leben jenseits der Opferrolle zu zeigen.
Aufbau | Guten Morgen Arkadij, hier ist Montag. Achtzehn Uhr, draussen ist Herbst, das neue Stück läuft irgendwo, das neue Buch ist erschienen, jetzt muss ich es an die Menschen bringen. Also, weil nur zählt, was sich verkaufen lässt. Soweit meine Kapitalismuskritik. Im Westen nichts Neues. Europa macht Krieg. Und du so?
Arkadij Khaet | Guten Abend, Sibylle, hier ist später Abend. Kein Krieg, nur Müdigkeit. Dienstag wie immer. Bücher kommen nicht, Stücke auch nicht, nur Mails. Herbst wird hier ignoriert. War im Kino und hab in die Sonne geschaut. Regie: Mascha Schilinski. Drei Jahre über mir auf der Filmschule, jetzt Preise im Akkord. Ich übe Neid. Der Film: impressionistisches Metaphern-Kino, vier Zeitebenen, dreissig Minuten zu lang. Ich bin in der Mitte zehn Minuten weggenickt – aber im Kino schlafen heisst, dem Film vertrauen. Zum Ende hin etwas hipsterig, ein Hauch Petzold. Publikum: graue Köpfe. Beim Rausgehen Omas belauscht: «Ja, schlecht war er nicht, aber gut?» – «Lang war er auch.» – «Ich muss nach Hause, die Katzen füttern.» Deutsches Publikum schaut bei Arthouse wie die Kuh ins Uhrwerk.
Aufbau | Ich habe deinen Film «Masel Tov Cocktail» vor einiger Zeit gesehen und war so glücklich. Endlich mal ein Film, der Juden wie – na, sag schon – Menschen zeigt. Nicht als Opfer oder verschieden. Oder deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen die Juden spielen und lustig sein wollen. Der Film war gross-artig, kein Hitler, kein Krieg, normales junge-Jungs-Leben. Du hast bestimmt vergessen, wie du auf die Idee kamst? War es ein Bild, eine Wut, ein angeödet Sein?
Arkadij Khaet | Es war alles – Wut, Erkenntnis, Wunsch. Vor allem Wut. Die Erkenntnis: In Deutschland weiss man über Juden nichts, ausser dass sechs Millionen ermordet wurden. Man beschäftigt sich mit jüdischem Leben – aber meint die Toten. Dara Horn nannte ihr Buch «Menschen lieben tote Juden». In Deutschland stimmt das mehr als anderswo.
Ich wollte zeigen, wie es ist, jüdisch und lebendig zu sein. Begegnungen, Sätze, Archetypen: Leute wollen Absolution, Umarmung, Schuldlosigkeit. Leute sind Anti-, Philo- und überhaupt. Ich war es leid. Mein Wunsch: ein Film, der die Frage «Wie ist es so als Jude in Deutschland?» überflüssig macht.
Aufbau | Ha, super Steilvorlage – und, wie ist es für dich in Deutschland?
Arkadij Khaet | Meine Familie kam in den 90ern als Kontingentflüchtlinge. Religiös waren sie nicht. Hannah Arendt haben sie nie gelesen. Aber stolz waren sie – auf Herkunft und Geschichte. Bei uns sagt man: Die Zionisten nach Israel, die Kapitalisten nach Amerika – und die Masochisten nach Deutschland. Und die Deutschen behandeln Juden, als würden sie Artenschutz betreiben. Wir sind wie so eine Kugel im Flipperautomaten, abgeschossen zwischen Schoah, Antisemitismus und Nahostkonflikt – und da kommt man nicht raus.
Aufbau | Sie wissen es nicht besser…
Arkadij Khaet | Im deutschen Kino nach ’45 sind Juden fast ausschliesslich Opfer: sichtbar als Juden - Kippa, Bart, Geige, Blick ins Nichts. Ausgerechnet ein goyischer Regisseur hat mir gezeigt, dass man diese Klischees mit einem Baseballschläger zerschlagen kann. Genau das wollte ich: Figuren mit Tiefe – wütend, aggressiv, Nasen brechend. Keine Klezmer-Folklore, keine Komparsen auf Gedenkveranstaltungen, keine Handreichung für Bürgermeister, keine Kulisse für «Nie wieder»-Floskeln.
So wurde der Cocktail gemixt. Fünf Jahre habe ich ihn dann ausgeschenkt: in Kinos, in Volkshochschulen im Thüringer Wald, in Schulaulen, wie eine Schluckimpfung gegen Antisemitismus von der Leinwand. Nach zweihundert Screenings war ich angeödet. Denn der Film endet – und doch beginnt erst die Inszenierung: Applaus, Anmoderation, dumme Fragen, traurige Gesichter, Empörung. Ich war als Beipackzettel zum Cocktail unterwegs. Erklärbärjude. Genug. Ich erkläre nicht mehr. Und du? Was hält dich dabei, ausser Verzweiflung?
Aufbau | Ab und zu schwache Momente von Wut. Es ist ja nicht so, dass der geballte Irrsinn gerade von Gott über die Welt gekippt worden wäre. Das Zeug haben wir zu verantworten: Mit Wahlentscheidungen, mit unserem Sein halten wir das System am Leben. Schade, dass Jude Sein nie cool geworden ist. Bis du gekommen bist, um uns alle zu retten. Vorher aber: wie geht es dir als das doppelte Böse gerade – Russe und Jude, das ist ein wenig wie Massen- und Serienmörder zusammen.
Arkadij Khaet | Du kannst mich «Jack the Ripperstein» nennen. Geboren in der UdSSR, heute Moldawien – oder wie man in den Tagesthemen sagt: Republik Moldau. Identität wird einem hier eh übergestülpt, wie ein Preisschild, das ständig an dir baumelt.
Ich wurde je nach Kontext immer anders anmoderiert. Früher «deutsch-russisch», nach «Masel Tov Cocktail» nur noch «jüdisch». Seit dem Russland-Ukraine-Krieg plötzlich «moldawisch». In Israel war ich «germani». Seit «Chabos» bin ich Duisburger. Ich finde das eigentlich ganz geil: Wenn man ausgegrenzt wird, kann man das Deutschsein beanspruchen. Die meiste Zeit kann man es wegschieben – weil: wirklich Deutscher sein will niemand. Dieses Hin und Her ist Luxus.
Natürlich wird das auch missbraucht, um jedem Schwachsinn Gewicht zu verleihen. In letzter Zeit lese ich ständig Sätze wie: «Ich als Jude finde ja (…)». Ich denke mir immer: «Du als egal wer kannst den Mund halten.»
Als ich mit dem «Cocktail» durch Deutschland tingelte, war ich irgendwann nur noch genervt. Kennst du dieses Begegnungsprogramm «Meet a Jew»? Das war ich. Ich war wie das Krokodil Gena aus dem sowjetischen Trickfilm: Gena ist ein Krokodil, arbeitet als Attraktion im Zoo und geht jeden Morgen hin, um sich von Kindern bestaunen zu lassen. Genau so habe ich mich gefühlt: wie das jüdische Krokodil, das durchs Land zieht, um begafft zu werden.
Aufbau | Es gibt im Kunst-Kultur-Kontext Menschen, die sich ausschliesslich über ihr Jüdischsein definieren. Sie tragen das «Ich als Jude würde dazu sagen» um den Hals. In Gold. Da, wo andere Juden eine Bank mit sich herumtragen, tragen sie ihre Zugehörigkeit, was man heute Identität nennt. Wie bist du diesem Kreis aus Zuschreibung und Elend entkommen?
Arkadij Khaet | Vielleicht mit «Chabos». Meine Prämisse: Da darf kein Jude drin vorkommen. Weg, freischwimmen. Zeigen, dass man auch ohne Juden Filme machen kann. Und beim nächsten Mal vielleicht wieder volle Judenpackung. Ich finde Juden übrigens sehr cool. Aber nicht, weil sie es sein müssen – sondern weil sie es trotz allem schaffen, aus Wut, Schmerz und Alltag Kunst und Humor zu machen. Coolness als Nebenprodukt, nicht als Pose.
Aufbau | Absolut. Aber wir wollten ja über «Chabos» reden – ich habe einige Folgen gesehen und fand es sehr lustig. Sag doch unseren cineastischen Lesern und Leserinnen, worum es geht.
Arkadij Khaet | Irgendwann vor ca. drei Jahren kam die «BBC» auf uns zu und meinte: «Schreibt mal alles auf, woran ihr euch aus dem Jahr 2006 noch erinnern könnt – gibt sogar Kohle.» Also haben Mickey, der Co-Autor, und ich «Chabos» geschrieben. Es geht um einen traurigen, selbstzentrierten Typen Mitte 30, der nicht zum Klassentreffen eingeladen wird. Das zwingt ihn, auf seine Jugend zurückzuschauen – und sich zu fragen, was in den Nullerjahren eigentlich schiefgelaufen ist. Ein Coming-of-Age auf zwei Zeitebenen. Die Serie basiert auf Erlebtem, Erinnertem und Ausgedachtem, in genau dieser Mischung. So ein halbwahrer, halb gelogener Freundschaftsmythos, den man sich nachts auf dem Balkon erzählt. Wir locken rein mit Nostalgie, Trash und Gags über Kazaa, Barbara Salesch und Miroslav Klose – und dann knallt’s. Am Ende ist es eine Serie über unfertige Menschen mit grosser Fresse und noch grösserem Herzen. Für alle, die ihre eigene Jugend wiederfinden wollen – so dreckig, laut und dumm, wie sie wirklich war. Die Schauspieler waren teils Profis, teils Kids – jetzt sind alle Profis. Und du: Wo warst du 2006, und was hast du Dummes gemacht?
Aufbau | Also mit hartem Abzählen der Nummern vermute ich stark, ich war in Zürich oder vielleicht auch in Zürich und Tel Aviv. Ich war noch nicht so irre lange verheiratet. Und habe recht wahrscheinlich ein Buch oder ein Stück geschrieben, denn ich schreibe immer ein Buch oder ein Stück. Tel Aviv ging zum Arbeiten nicht, weil ich hören muss, was die Menschen so reden, sonst sitze ich wie in einem leeren Pool in meinem Kopf und beginne, Heimatromane zu schreiben, mit kleinen Ziegen. Erinnerst du dich genau an absurde Dinge wie 2006? Bist du verheiratet? Findest du es auch so grossartig? Warst du schon mal in Israel? Wolltest du da auch mal wohnen oder hast es versucht? Wie findest du Greta und begeisterte «Queers for Palestine», und wie kann man eigentlich die Welt oder den Ausschnitt, den man sich aussucht, aushalten?
Arkadij Khaet | Ich nehme dich ernst und gebe ehrliche Antworten auf rhetorische Fragen. 2006? Klar erinnere ich mich. WM-Sommermärchen, Dönerspiesse in Nationalfarben, und ich war wahrscheinlich der einzige Typ auf dem Schulhof, der «Deutschland, Deutschland» mitsang und sich dabei wie ein Verräter an allen Vorfahren fühlte. Absurd trifft’s ziemlich gut. Baruch Hashem. Verheiratet bin ich, ja. Es gibt nichts Tröstlicheres, als zu wissen, dass man nicht allein untergeht. Und zu Israel habe ich auch eine Beziehung. Seit Kindheit volle Zio-Schlammpackung aus dem Toten Meer getrunken: Chanich, Madrich, «Birthright», Leadership-Year Baretz, Kibbutz, Ulpan, Hasbara. Dazu Sonne, Schweiss, Granatapfelsaft. Wohnen wollte ich da auch, aber das waren mehr Kindergedanken als Pläne. Zum 1. April damals habe ich meiner Mutter geschrieben, ich mache Alija. Kein Lachen, eher Zusammenbruch. Danach lange nicht mehr drüber nachgedacht. Jetzt taucht der Gedanke manchmal wieder auf, leise, wie ein Reflex.
Greta und «Queers for Palestine» – ich find’s grundsätzlich gut, wenn Leute sich engagieren, solange sie wissen, wofür und wogegen. Ich beneide die Leidenschaft, aber nicht den Mangel an Zweifel. Wenn Moral das Denken ersetzt und Aktivismus zur Identitätsperformance wird – dann wird’s Theater. Und da vergisst man leicht, dass echte Menschen in echten Konflikten leben. Und Theater ist wohl auch die Antwort auf deine letzte Frage, wie man den Müll erträgt. Ich filtere, dosiere, lache, lösche. Ich mache Filme. Oder Witze. Oder beides. Man muss lachen, sonst wird man zynisch. Und Zynismus hebe ich mir für die Rente auf. Ich halte mich fern. Kein Scrollen, keine Petitionen. Ich mache Sport, schreibe Drehbuch, halte still. Vielleicht ist das die neue Form von Widerstand: nicht alles mitzumachen. Nicht dauernd Recht haben zu wollen.
Du wirkst oft, als hättest du alles durchschaut. Schreibst diese ganzen klugen Bücher und Stücke. Aber gibt’s noch irgendwas, das dich überrascht?
Aufbau | Ich habe keine Ahnung, von nichts. Ich bin daher auch immer begeistert, wenn ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Technikern und Technikerinnen zu tun habe, die ich für mein angebliches Wissen aussauge. Sie wirken oft so sicher. Wusstest du, dass sehr viele Astrophysiker an einen Gott, Elohim, wie auch immer sie es nennen, glauben? Das fand ich erst erstaunlich, dann logisch, denn sie kommen alle an den Punkt des «und was war vor dem uns bekannten Anfang von allem?»
Arkadij Khaet | Ist wahrscheinlich wie bei Künstlern: Man starrt lange genug ins Nichts, und irgendwann schaut was zurück. Mich beruhigt das – nicht, weil ich gläubig bin, sondern weil ich mag, dass sie zweifeln.
Aufbau | Der Widerstand gegen den Widerstand, das «nein, ich habe keine Meinung und keine Ahnung» basiert auf dem Wissen, dass es auch komplett egal ist, ob wir uns über etwas aufregen, worauf wir keinerlei Einfluss haben. Ich denke mir immer, wenn ich all die Petitionen und Briefe gegen irgendein Unrecht sehe: Räumt doch erst mal in eurer Nachbarschaft auf. Viele der Massenhysterie-Proteste heute sind rührend, denn die Menschen suchen ein Ventil für ihr Unwohlsein, und kaum einer wagt, das System zu hinterfragen, das uns alle verblödet hat.
Arkadij Khaet | Diese ganze Empörungsökonomie ist erschöpfend. Kollektives Tourette gegen die Bedeutungslosigkeit. Und trotzdem: Ich kann die Menschen verstehen. Sie wissen, dass sie nichts ändern, aber sie wollen nicht ganz tatenlos sein.
Aufbau | Apropos, sag mir noch – deine Arbeit –, wie fing es an und hast du ein sogenanntes Ziel? Einen Traum? Oder ist der Traum, weitermachen zu können, einfach zu machen, weil das schon die Erfüllung ist?
Arkadij Khaet | Ich glaube, man fängt an, weil man hofft, dass Arbeit Bedeutung macht. Später ist die Arbeit selbst die Bedeutung. Ein Ziel? Keins, das man aufschreiben könnte. Ich will einfach weiterarbeiten, solange es noch Spass macht und niemand merkt, dass ich improvisiere. Weitermachen, bis einer das Licht ausmacht. Oder bis der Krieg beginnt? Oder endet? Morgen kommen die Geiseln frei.
Aufbau | Nun liegt das Morgen schon hinter uns, jetzt warten wir auf die Ermordeten, ganz unter uns, ohne eine erkennbare Massenempathie. Als ich für tachles kurz nach dem Terrorangriff der Hamas einen verzweifelten Text schrieb, waren die ersten Reaktionen im Netz, was ja nicht viel heisst: «Schäm dich.» Das habe ich dann nicht gemacht, denn wenn man beginnt, sich für Menschlichkeit zu schämen, kann man eigentlich alles sein lassen. Das mit der Kunst sowieso.
Sag mir: Kontrollierst und zensierst du dich schon bei deiner Arbeit? Denkst du Triggerwarnungen mit, und alle Konflikte und Diskurse, die gerade so laufen und die einem Künstler sehr schnell Schwierigkeiten machen können, wenn man eine «falsche» Haltung, Meinung oder Herkunft hat? Ausladungen, das Ausbleiben neuer Aufträge – Zeug, das schwer nachzuweisen ist, weil – vielleicht ist die eigene Arbeit ja auch nicht Mist.
Arkadij Khaet | Ich arbeite für das Jüdische Filmfestival Berlin Brandenburg. Oder was heisst «arbeite» – ich sehe Filme aus der ganzen Welt und kuratiere im Team ein Programm. Mehr Freude als Job. Dadurch bin ich im Austausch mit israelischen Filmemacherinnen und Filmemachern. Die Stimmung ist miserabel. Der Unterschied zum stillen Boykott vieler Festivals früher ist, dass er jetzt laut stattfindet – mit Begründung, Pathos und moralischer Selbstzufriedenheit. Die linkesten, lautesten, friedfertigsten Israelis – gecancelt von denen, für deren «Sache» sie einmal mitgelaufen sind.
Israel ist zum Symbol geworden: für Kolonialismus, Rassismus, westliche Hegemonie.
Und Antizionismus gilt inzwischen als moralische Währung der Filmwelt. Naja,… Jude ist man nicht, man wird dazu gemacht. Im Vergleich dazu arbeite ich im Luxus der öffentlich-rechtlichen Staatsräson. Aber klar kontrolliere ich mich auch. Man wäre ja dumm, es nicht zu tun. Manchmal ist das Überleben, manchmal Feigheit. Ich versuche, den Unterschied zu erkennen. Die Gedanken an die Rezeption laufen beim Machen immer mit. Filme sind Kunst, aber auch Ware. Und wo Geld fliesst, fliesst Meinung mit.
Ich schreibe gerade an einem Drehbuch, das in der deutsch-jüdischen Öffentlichkeitswelt spielt. Angefangen hatte ich lange vor dem 7. Oktober – jetzt muss man alles neu denken: Figuren, Ton, Sprache. Vielleicht ist das heute das Einzige, was man tun kann – weiterarbeiten, ohne sich zu entschuldigen. Nicht trotzig, nur konsequent. Während ich das schreibe, fällt mir auf: Du solltest darin einen Auftritt haben. Du hast vor der Kamera genau die Art von Präsenz, die man nicht inszenieren kann. Ich schicke dir das Drehbuch, sobald es überlebt hat. Dann kannst du immer noch absagen.
Aufbau | Ich kann nur gucken, aber das ist genial. Reden, agieren ist bei mir gleich null. Ich liege am liebsten und gucke. Nur so, für meine Rolle. Und wir werden den Hass auf Juden nie besiegen, er ist so einfach. Ein Gegner, auf den sich alle einigen können. Wir können versuchen, Kunst zu machen, die hilft. Es ist schön, dass wir uns getroffen haben - und gut, dass es dich gibt.
Und eine Umarmung an alle in diesen seltsamen Zeiten. Lasst euch nicht ängstigen. Und zur Beruhigung: schaut Arkadijs Filme.
Arkadij Khaet | Danke, Sibylle. Ich umarme zurück. Und ich verspreche, ich schreibe die Rolle genau so: eine, die liegt, guckt und mehr versteht als alle, die reden. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann: liegen und gucken. Mehr Wahrheit gibt’s nicht.
Sibylle Berg gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autorinnen und lebt in der Schweiz.